Leseprobe: 1. Kapitel
Alle Rechte liegen beim Schutter Verlag!
Nennt mich Salvatore. Einst, als mein Vater uns verließ, gab man mir diesen Namen. Warum, weiß ich nicht. Den früheren vergaß ich und einen zweiten Namen oder Titel habe ich nicht und weiß von keinem. Vor langer Zeit verließ ich das Dorf, das klein und dürftig am Fuße der grauen Bergfelsen hingekauert war, und begann meine Wanderschaft ins Leben.
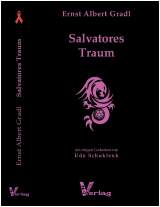
E. A. Gradl liest aus Salvatores Traum
zur Leipziger Buchmesse 2011 - Termine folgen...
Es wird Zeit, daß ich sie erzähle, meine Geschichte, die so dunkel und tragisch, aber auch so schön und glücklich war, die, voller Schrecken und Grauen, Tod und Teufel trotzte. Nun eins nach dem anderen, schön langsam der Reihe nach.
Ich habe keinen Tag der Geburt, denn man hat versäumt, ihn mir zu sagen. Eigentlich schade, aber was soll ich darüber trauern. Ich feierte meinen Geburtstag, wann immer ich wollte, oft mehrfach im Jahr, mal im Herbst, dann wieder im Sommer oder im warmen Frühling und manchmal an einem kalten Winterabend.
Ich weiß auch nicht die Zahl meiner Geschwister, fünf oder sechs. Doch den Namen meiner Mutter, nun den weiß ich wohl. Isabella, die Gute und Sanfte, die immer gewartet hat, daß ihr Herr zurückkehrt.
Nie kam Kunde aus dem Heiligen Land, in das er ausgezogen war, es zu erobern, nie erreichten Nachrichten das Dorf am Rande der apuanischen Berge.
So blieb sie allein inmitten der Kinderschar, und mit den Bauern, die wortkarg neben ihr auf den Feldern säten und ernteten, bestellte sie die kargen Böden und versuchte ihre immer hungrige Schar durch die Jahre zu bringen, Sommer wie Winter.
Eines Tages, ich war noch ein Kind, wurde es an der Zeit, daß auch ich helfen mußte, und da ich gesund und kräftig war, wanderte ich hinauf in die Berge zu den Steinbrüchen. Dort gab es harte Arbeit, aber auch Gold und gutes Brot.
Diese Zeit will ich aber nur kurz streifen, denn so wichtig und entscheidend sie auch für mein Leben ist, so ist es nicht die Geschichte, die ich euch erzählen will.
Bei den Steinbrüchen inmitten der rauen Felsen, die den begehrten schneeweißen Marmor bargen, inmitten dieser rauen Menschen, die wie diese Felsen hart waren, doch mit Herzen glänzend und rein wie dieser Marmor, wurde ich geformt und erhielt meine ersten Lektionen.
Ein kühler, düsterer Bildhauer, der den Bruch seiner Steine überwachte, wurde auf mich aufmerksam, handelte mit meinem Steinbruchmeister und nahm mich mit zu seiner Werkstatt. Da sah ich nun Genua und das Meer. Zum ersten Mal am Strand hingekauert, schimmerte das unendliche Blau vor meinen Augen und zog mich unwiderstehlich an.
In der Werkstatt des Meisters wurde mir eine dunkle Ecke zugewiesen, und dort auf einer abgenutzten und schäbigen Holzplatte zeigte mir einer der Gesellen einen alten, grauen Stein.
„So, Lehrling, das ist dein erstes Werk. Wie ich gehört habe, hast du schon oben in den Bergen im Steinbruch gearbeitet. Aber das hier ist etwas anderes. Hier hast du schon ordentlicher und sauberer zu arbeiten.“
Langsam begann ich mich zu ärgern. Was wollte dieser unfreundliche Kerl? Er soll mir erklären, was zu tun ist, und keine Reden schwingen.
„Darf ich erst einmal meine Fähigkeiten zeigen, bevor ihr mir Schlampigkeit und Unfähigkeit vorwerft?“
„Hoho – ja so einer, auch noch frech, ja dann zeig mir mal, was du kannst. Der Stein ist krumm, und bevor du etwas daraus machen kannst, will ich ihn rechtwinklig als schönen Quader sehen, hast du mich verstanden? Wie heißt du eigentlich?“
„Salvatore“
„Aha, Salvatore. Das ist mir zu lang. Ich werde dich Salvo nennen.“
Er grinste. „Ich bin Julius. Willkommen.“
Überraschend freundlich reichte er mir die Hand.
So begann mein erster Tag. Julius freundete sich sehr schnell mit mir an. Er hatte eine kräftige Statur und war einen Kopf größer als ich, aber das Außergewöhnlichste an ihm war seine Löwenmähne, denn er ließ sich die Haare nur selten und auf halbe Länge schneiden und behauptete, daß freie Männer nicht mit geschorenen Köpfen herumlaufen. Das mag schon sein, aber in dieser Stadt gab es einfach zu viele Läuse, und so zog ich es vor, mir lieber den Kopf scheren zu lassen, denn dann sparte man sich die ewige Kratzerei am Kopf.
Mit mir gab es nur drei Lehrlinge und noch vier Gesellen, die tüchtig tagein und tagaus arbeiteten. Der Meister hatte so seine Launen, allerdings konnte man ihn schon ertragen, und er lehrte uns allen bereitwillig alle Fertigkeiten des Steinbildhauerhandwerks.
Ich selbst durfte über der Werkstatt mit Julius wohnen, und ich erhielt sogar ein eigenes Bett. Julius bemerkte schon nach wenigen Tagen, daß bisher noch niemand mir Lesen und Schreiben beigebracht hatte.
Einige Worte konnte ich schon entziffern, denn der Pfarrer in unserem Dorf hatte einen Sommer lang den Kindern und auch mir ein wenig das Lesen und das Schreiben des eigenen Namens beigebracht, aber der Sommer war schnell vorüber, und der Priester wurde wegbeordert oder verließ die armselige Gegend, um an einem besseren Ort zu predigen. Der neue Priester interessierte sich nicht für Kinder, und die Ministranten waren froh, wenn er sie nicht allzu oft verprügelte.
Julius allerdings hielt mir die erste Seite der Bibel vor die Nase und befahl: „Lies!“
„D – I – E „ Ich riß mich zusammen.
„Die. Da steht die. Die!“
Julius lächelte. „Ja, schön, sehr gut. Und das nächste Wort?“
„E. Das ist wieder ein E, und das zweite ein R – Er – die Er – die Erde – die Erde und noch irgendwas – ich hab jetzt keine Lust mehr.“
„Salvo! Das heißt nicht Erde!“
„Nein?“
„Nein!“ er setzte sich neben mich und griff nach dem Buch und dann las er:
„Die Erschaffung der Welt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.“
Er hielt inne. „So, und jetzt liest du es.“
Damit begannen meine nächtlichen Studien, und ich hatte das große Glück, einen geduldigen und liebevollen Lehrmeister gefunden zu haben.
„Gott sprach: Es werde Licht.“ Als ich diese Zeilen las, verstand ich die ersten zusammenhängenden Sätze des Buches, ja auch bei mir, im meinem Verstand, begann ein Licht zu leuchten, und es hat mich nie wieder verlassen.
Unser Meister hatte seine Eigenarten. Eine davon liebten wir alle. Unser Meister haßte den Anfang der Woche, er verabscheute ihn so sehr, daß er sich selbst und auch uns kaum zumuten konnte, an diesem Tag zu arbeiten. So begannen wir am ersten Morgen nach dem Sonntag, der heilig war und an dem wir alle frei und allzu fröhlich den ganzen Tag und die halbe Nacht gefeiert hatten, langsam, allzu langsam mit unseren Tätigkeiten. Der Meister ließ sich den ganzen Vormittag nicht blicken, angeblich zeichnete er in seinem Arbeitsraum, der auch eine Art Kontor für Gäste und Kunden war, und wenn man ihn störte, da ein Kunde in der Werkstatt wartete, dann warf er, wenn er allzu schlecht gelaunt war, einen Schemel gegen die Tür und verjagte mit Gebrüll den Gast auf Nimmerwiedersehen. Eigentlich wußten die Herrschaften, meist kirchliche Würdenträger und deren Diener, daß der Montag ein sehr schlechter Termin für einen Besuch bei uns war, so daß nur Fremde ab und zu hereinschneiten und dies nie wiederholten.
Gegen Mittag erschien er, Urban, der Steinmetzmeister, mürrisch und übellaunig.
Er winkte einen der Gesellen zu sich.
„Hol ein Faß Bier und schick einen Lehrling zum Bäcker, jetzt ist Mittag, und ich habe Durst.“
Darauf hatten wir alle gewartet, denn das hieß, daß der Nachmittag sehr gemütlich werden würde und jeder einen Humpen Bier erhielt. Für Unterhaltung war gesorgt, denn Urban erzählte allerlei Abenteuer, schimpfte gerne über den nichtsnutzigen Adel und die fetten Priester, spottete über den Rat der Stadt und schenkte reichlich Bier nach, so daß mancher von uns oft gegen Nachmittag betrunken am Tisch einschlief. Dann lachte Urban dröhnend und weckte den armen Kerl unsanft mit einem Schlag auf den Rücken.
„Hier wird nicht geschlafen! Hör zu, damit du was lernst!“
Einer der Lehrlinge, wir nannten Ihn Lupo, den Wolf, freundete sich mit mir an, und ich lernte bald seine Familie kennen. Ich staunte über den Reichtum, über den die Familie Fontana, so nannte sie sich, verfügte, und ich stellte mit Verwunderung fest, daß dieser Lehrling aus reichem Hause das gleiche Handwerk erlernte wie ich. Lupo schätzte meine Freundschaft und meine Armut störte ihn nicht. Gemeinsam mit seinen Freunden und einer wunderbaren Freundin, die bereits auserwählt war, wenn er selbst Meister werden würde, seine Gemahlin zu werden, verbrachten wir eine fröhliche Zeit entweder im Stadthaus der Familie Fontana oder noch viel fröhlicher auf dem Landgut.
Der Vater von Lupo, eine stattliche Erscheinung, reich gekleidet, besaß zahlreiche Rinder und in der Stadt die größte Schlachterei, die das frische Fleisch an die Metzger verkaufte. Der Sohn verabscheute allerdings dieses Handwerk und fühlte sich zur Kunst hingezogen, aber der Vater hatte dafür durchaus Verständnis, und auch er schien sein blutiges Handwerk nicht zu lieben.
Lupo war ein fröhlicher Mensch, immer zu Späßen aufgelegt, und nichts deutete darauf hin, daß sein Lebensweg, der eigentlich wie ein herrlicher Pfad zum lichten Gipfel schien, an einem Abgrund endete.
Hier erfuhr ich zum ersten Mal, daß es im Leben keine Sicherheit gibt, daß das Unglück plötzlich erscheint, ein ungebetener Gast, der seinen dunklen Mantel zurückwirft und der das Beil des Henkers emporschwingt und auf den Unglücklichen niedersausen läßt ohne zu zögern und ohne Erbarmen.
Ich erinnere mich noch gut an den Abend, als Regina, die ebenso heitere Freundin von Lupo, mit uns über die abendlichen Felder ritt. Sie selbst besaß ein edles Pferd, eine rotbraune Stute, und wir folgten ihr auf Eseln. Nur Lupo hatte noch einen schwarzen Hengst, der dem Tier der zukünftigen Gattin ebenbürtig war. Spät am Abend kehrten wir in ein Wirtshaus ein, auch Julius war dabei, und wir bestellten Wein. Julius spielte allerlei zotige Lieder auf der Laute, und ich schlief irgendwann betrunken unter dem Tisch.
Plötzlich weckte mich jemand. Es war der Wirt. Ein müder, schon greisenhafter Mann. Ich wußte sogleich, daß etwas Schreckliches geschehen war. Sonderbarerweise spürt man das sofort. Die Art, wie man geweckt wird, der Blick der Freunde. Alle schienen nüchtern, und es herrschte eine unheimliche Stille.
„Julius, was ist geschehen?“ Ich zupfte den Freund am Ärmel, denn scheinbar war ich der einzige, den man noch nicht informiert hatte. Vermutlich weil man vergaß, daß ich unter dem Tisch eingeschlafen war. Ich dürfte damals vielleicht fünfzehn Jahre alt gewesen sein. Eigentlich ziemt es sich in dem Alter nicht, wie ein Kind unter dem Tisch zu schlafen, aber ich war müde und betrunken, und Geld für ein Bett in der Herberge hatte ich nicht übrig.
„Regina ist tot, “ flüsterte mir Julius zu. Ich war entsetzt. Wie konnte dies möglich sein?
Bald erfuhr ich, was sich zugetragen hatte.
Lupo und Regina, angeheitert vom Wein, hatten einen nächtlichen Ausritt beschlossen. Der Mond leuchtete hell, die Nacht war warm und sommerlich, und beide sehnten sich nach Abenteuer und einem Bad im Meer. Möglicherweise ergab sich ein Wettrennen, wir erfuhren es nie, denn Lupo schwieg über diese Nacht. Jedenfalls ritten beide die Hügel hinunter zum Wasser und irgendwo auf diesem Weg, Julius wußte wo, aber ich habe es mir nie angesehen, es nie sehen wollen, da streifte der Ast einer Pinie die Reiterin und warf sie ab. Sie war sofort tot.
Als man mich fand und weckte, wurde sie gerade hereingebracht und auf einen der Tische gelegt. Sie sah wunderschön aus, ihr langes braunes Haar, das einen rötlichen Schimmer hatte umspielte mit herrlichen Locken ihr zartes Antlitz. Es schien, als schliefe sie. Lupo starrte sie stumm an, sie schlief für immer.
Die traurige Beerdigung, sie war das einzige Kind einer ehrbaren Familie von niederem Adel, die als Buchdrucker ihr Brot verdienten, leitete den unheimlichen Niedergang der Familie Fontana ein. Zunächst hielt sich die trauernde Familie mit Anschuldigungen zurück, zumal der Unglücklichste von allen Lupo Fontana war, der still vor sich hin weinte und tagelang schwieg.
In der Werkstatt herrschte bedrücktes Schweigen, und zunächst ließen wir Lupo mit seinem Kummer so lange in Ruhe, wie es uns möglich war.
Doch schon nach einigen Tagen stellten wir fest, daß seine Reden eigenartig schienen, und die Woche verging und noch eine Woche ging vorüber, aber es wurde nicht besser. Lupo suchte irgend etwas in den dunklen Ecken der Werkstatt, er verschwand stundenlang irgendwohin, dann fanden wir ihn im Hinterhof zwischen den alten Statuen, die er anstarrte. Dort stand auch eine von einem früheren Meister geschaffene Figur, die einen Faun darstellte, einen kleinen bocksbeinigen Kobold mit einer Flöte und mit Hörnchen auf der Stirn. Plötzlich hörten wir Lärm, eilten in den rückwärtigen Garten und sahen entsetzt zu, wie Lupo die Marmorfigur mit dem Hammer zerschlug.
„Du Teufel, du Teufel!“ schrie er immer wieder. „Ich hasse dich, du Teufel!“
Irgendwann gelang es dem Meister, den Tobenden zu beruhigen, und er rief nach dem Vater von Lupo, der ihn mit einer Kutsche fortbrachte.
Zweimal noch sollte ich meinen armen Freund wiedersehen. Zuerst besuchten wir, Julius und ich, ihn im Stadthaus der Familie. Doch er sprach nicht mit uns, starrte auf seinem Bett liegend gegen die Decke, und irgendwann schickte uns der Arzt mit den Worten, daß es leider keinen Sinn habe, nach Hause.
Schon nach wenigen Tagen, es war ganz sicher kein Montag, denn wir staunten, daß unser Meister mitten in der Woche nach Bier schicken ließ, erfuhren wir durch Urban vom weiteren Schicksal der Familie Fontana.
Es hatte in der Stadt einige ungeklärte Todesfälle gegeben, und die Schlachterei von Lupos Vater war beschuldigt worden, altes vergiftetes Fleisch verkauft zu haben. Ob dies wahr gewesen ist, erfuhren wir nie, aber der alte Fontana wurde angeklagt und für einige Tage eingesperrt. Unser Meister schimpfte auf die korrupte Gerichtsbarkeit, und wir sorgten uns sehr um die Zukunft der Familie und um unseren kranken Freund.
In diesen Tagen verbrachte ich meine freie Zeit am Hafen, betrachtete voller Sehnsucht die Schiffe, die dort ankerten, und als Julius einmal mit mir die Kaimauer entlang wanderte, fragte er mich, ob ich fort wolle.
„Ja, ich will aufs Meer. Kannst du das verstehen?“, antwortete ich ihm.
„Sicher verstehe ich das, aber beende deine Lehre, dann erst heuere auf einem Schiff an. Versprich mir das.“
„Julius, ich weiß es nicht. Ja – vielleicht. Wenn der Meister mich ziehen läßt, dann werde ich Matrose.“
„Gut. Ich hoffe du findest, was du suchst.“ Nachdenklich schwieg Julius.
Am nächsten Tag rief der Meister uns zusammen.
„Der alte Fontana hat sich erhängt. Man hat ihn frei gelassen, dann ist er auf den Dachboden seines Hauses und nahm den Strick. Angeblich hat er seine Verbrechen gestanden. Auf der Folter.“
Das Wort Folter sprach Meister Urban mit tiefer Verachtung aus, und mir wurde klar, daß mich in dieser Stadt nicht mehr viel hielt.
Die Familie Fontana wurde enteignet und verarmte jämmerlich.
Wir suchten Lupo und erfuhren von seiner Schwester, daß man ihn in ein Kloster gebracht habe.
Julius und ich machten uns auf, dieses Kloster, das einen halben Tagesmarsch entfernt in den Bergen war, zu besuchen.
Dort erblickte ich Lupo ein letztes Mal. Angekettet, in Lumpen und mit einem rostigen Halsring wie ein Tier im Stall des Klosters. Er brummte und wimmerte, aber er erkannte uns nicht. Julius streichelte und umarmte ihn, da weinte er. Ich stand nur stumm und entsetzt herum, und auf dem Rückweg weinte auch ich.
In dieser Nacht schlich ich mich zum Hafen und starrte stundenlang auf das dunkle Wasser.
Weitere Infos zum und über das Buch ab 10/2010 im Internet:
www.salvatores-traum.de



